- Vorwort - Grundsätzliches
- Rechtsunsicherheit
- Klassische Auktionen
- Online-Auktionen - Unterschiede
- Rechtliche Sicht
- Gerichtliche Beschlüsse
- Anzuwendendes Recht
- Konsumentenschutzgesetz
- Arten von Online-Auktionen
- Zusätzliche Features
- Haftung für Inhalte und Werberecht
- Risiko für den Kunden
- Treuhandmodell
- Nutzen
- Zukunftsperspektiven
- Anmerkungen
- Vorwort - Grundsätzliches
In Europa gibt es Auktionen bereits seit dem 17. Jahrhundert, als Kunsthändler ihre Ware im Wege der Versteigerung auf den Markt brachten.
Doch erst durch die Verbreitung des Internet werden Auktionen einer großen Bevölkerungsschicht (unabhängig von Zeit und Ort der Veranstaltung) zugänglich. Das neue Medium erfreut sich als Plattform für Versteigerungen in den letzten Jahren steigender Beliebtheit.
In den USA gibt es seit 1995 Unternehmen, die ihre Produkte über Auktionen im Wordwide Web verkaufen. Im deutschsprachigen Raum begann dieser Trend der Online Auktionen erst 1998. Seither steigt die Anzahl der Auktionsteilnehmer und auch die der Anbieter zusehends. Die erfolgreichsten deutschen Auktionshäuser haben mittlerweile zwischen zehn- und fünfzehntausend registrierte Teilnehmer und erwirtschaften sowohl durch ihre Gewinnbeteiligung, als auch durch Versteigerungsgebühren und auf den Internet Seiten geschaltete Bannerwerbungen satte Gewinne. [8], [12]
Die folgende Statistik zeigt die Besucherzahlen der bekanntesten deutschen Online Auktionshäuser im Dezember des Vergangenen Jahres [5].
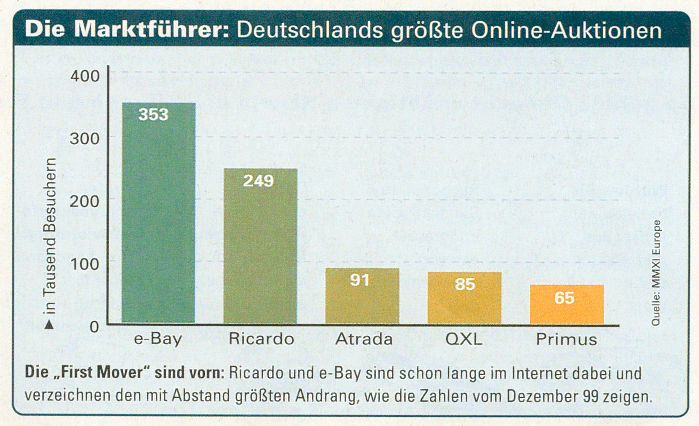
Abb. aus [5]
- Rechtsunsicherheit
Wurde im vorangegangenen Absatz oder wird in weiterer Folge der Begriff "Auktion" für eine Online Auktion verwendet, so ist das (zumindest in rechtlicher Hinsicht) nicht ganz richtig. Online Auktionen sind keine Auktionen, wie sie in der Gewerbeordnung festgelegt sind. Weitmehr handelt es sich bei ihnen um sogenannte "Verkäufe gegen Höchstgebot".
Weitgehend ungeklärt sind auch noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen dieser in letzter Zeit sehr beliebt gewordenen Form der Versteigerung. Abgesehen von einigen exemplarischen Rechtssprüchen gibt es im deutschsprachigen Raum bis jetzt noch keinen Gesetzestext der sich mit den rechtlichen Aspekten von Online-Auktionen befaßt.
- Klassische Auktionen
Eine Auktion ist dadurch definiert, daß ein Auktionator entweder im eigenen Namen (meist für fremde Rechnung), oder im fremden Namen den am Versteigerungsort Anwesenden Personen gebrauchte Gegenstände zu einem Mindestpreis anbietet. Der Bieter, der den Zuschlag durch den Auktionator erhält, bekommt den Kaufvertrag. Den Zuschlag wiederum erhält derjenige, der in unmittelbarer Konfrontation mit seinen Mitbewerbern das höchste Gebot abgibt.
In der Gewerbeordnung, insbesondere in der "Versteigerungsverordnung" legt der Gesetzesgeber besondere Grundsätze fest, die jeder Anbeiter von Versteigerungen einhalten muß. Dazu zählen:- eine Ankündigung der Auktion bei der zuständigen Behörde
- das Angebot an die Interessenten die zu versteigernden Waren vorher zu besichtigen
- eine öffentliche Bekanntmachung von Zeit und Ort
- ein Versteigerungsverbot an Sonntagen und so weiter.
Um zugleich den herkömmlichen Handel vor übermäßiger Konkurrenz durch das Versteigergewerbe zu schützen, verbieten die gewerberechtlichen Vorschriften außerdem den Verkauf von Neuwaren.
Bei Online Auktionen werden diese gewerberechtlichen Vorschriften offensichtlich nicht eingehalten, deshalb ist auch die Bezeichnung "Auktion" bei dieser Form der Warenveräußerung nicht der einer "regulären" Auktion gleichzusetzen, was die Rechtsauffassung betrifft .[4]
- Online-Auktionen - Unterschiede
Online Auktion unterscheidet sich von einer herkömmlichen Auktion in folgenden Punkten:
- Bei Internet Auktionen werden nicht nur gebrauchte, sondern auch neue Gegenstände verkauft
- Der Käufer kann die Ware nicht im Original betrachten, sondern ist darauf angewiesen, daß sie den Beschreibungen entspricht, die er während der Auktion erhalten hat
- Die direkte Konfrontation der Teilnehmer mit ihren Mitbietern ist nicht gegeben, daher kann ein Auktionsteilnehmer beispielsweise nicht herausfinden, ob ein Mitbieter lediglich den Preis in die Höhre treiben will (beispielsweise durch Blick-Kontakt)
- Käufer wird nicht derjenige, der den Zuschlag erhält, sondern derjenige, der bei Ablauf der Zeit das höchste Gebot abgegeben hat
- Der zeitliche Rahmen, in dem eine Online Auktion stattfindet geht
im Normalfall weit über den einer herkömmlichen Auktion hinaus. Mehrere
Tage oder Wochen Laufzeit sind bei Online Auktionen nichts Ungewöhnliches.
- Rechtliche Sicht
Online Auktionen werden sowohl von Privatpersonen genutzt, als auch von Unternehmen, die ihre Handelsware an den Meistbietenden verkaufen möchten. Das heißt, es kommt zu einem Kaufvertrag zwischen Anbieter und Meistbietendem. Dabei gelten die allgemeinen Bestimmungen für einen Vertragsabschluss nach § 861 des KSchG [1]:
Von einem Angebot ist nur dann die Rede, wenn der Inhalt des Vertrages ausreichend bestimmt ist und ein endgültiger Bindungswille darin zum Ausdruck kommt. Gerade dieser Bindungswille wird bei Online-Auktionen von der Käuferseite nicht zum Ausdruck gebracht, weil er sich nicht an eine spezielle Person, sondern an eine unbestimmte Anzahl von Bietern richtet. Daraus folgt, daß der Bieter in einer Online-Auktion lediglich ein Angebot ausspricht, das der Verkäufer annehmen kann oder nicht.
Diese Sichtweise ist ein wenig antiquiert und entspricht nicht dem allgemeinen Verständnis des Auktionsgedanken, aber sie liegt der derzeiten Rechtslage zugrunde, wie auch ein Urteil des Landesgerichts Münster im Falle eines nicht erfolgten Autoverkaufs zeigte: Ein Autohändler bot einen neuen VW Passat mit einem Listenpreis von deutlich über 50.000 DM im Rahmen einer Online Auktion an, ohne einen angemessenen Mindestpreis zu definieren. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie im auszufüllenden Auftragsformular erklärte sich der Verkäufer im Voraus mit dem späteren Höchstgebot einverstanden. Dieses betrug nach Ablauf der festgelegten Auktionszeit allerdings keine 30.000 DM. Als der Käufer nun die Herausgabe des ersteigerten Fahrzeuges verlangte, lehnte der Verkäufer ab. Er argumentierte, das Gebot des Käufers stelle nur ein Angebot an ihn dar, das er seinerseits annehmen oder ablehnen könne. Sein Versteigerungsauftrag an den Auktionator sei nicht als Verbindliches Verkaufsangebot zu sehen. - Das Landesgericht münster gab dem Verkäufer Recht. Weniger rosig sieht die Sache für den Käufer aus. Hat dieser ein Objekt ersteigert, so kann er vom Kauf nicht mehr zurücktreten. [4]
- Gerichtliche Beschlüsse
AG Sinsheim "Internet-Auktion" (Az.: 4 C 257/99)
Der Kläger hatte auf einer "Internet-Auktion" fünf gebrauchte Monitore in gutem Zustand von der Beklagten zu einem Preis von DM 1.000,- erworben. Die Beklagte verweigerte daraufhin die Lieferung. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Übergabe und Eigentumsverschaffung Zug um Zug gegen Zahlung aus Kaufvertrag. Zwischen den Parteien wurde im Rahmen einer "Internet-Auktion" ein Kaufvertrag geschlossen, da der Kläger bis zum Ende der "Auktionszeit" der höchste Bieter war. Beide Vertragspartner haben sich mit den Nutzungsbedingungen des Internet-Auktionators einverstanden erklärt.[7]
Urteil vom 10.01.2000 LG Münster "Versteigerungen im Internet - ricardo.de" (Az.: 4 O 424/99)
Bei Versteigerungen im Internet kommt kein wirksamer Kaufvertrag zustande. Da der Verkäufer dem Internet-Auktionshaus keine rechtsverbindliche Vollmacht erteilt hat, ist sein Internetangebot lediglich als "Aufforderung zu Abgabe von Kaufangeboten (invitatio ad offerendum)" zu verstehen. Zum Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages muß der Verkäufer das Angebot des Käufers noch einmal ausdrücklich akzeptieren. Urteil vom 21. Januar 2000 [7]
- Anzuwendendes Recht
Zu unterscheiden sind zwei Fälle: Das anzuwendende Recht wird von den beiden Vertragspartnern vereinbart (und muß keinerlei Beziehung zum Gegenstand des Vertrages haben), oder es wird kein Recht gewählt. In letzterem Fall kommt das Recht des Staates zur Anwendung, in dem die "charakteristische Leistung" erbracht wurde, in diesem Fall der Sitz des Verkäufers.
In Europa besteht zwar die freie Rechtswahl, doch sind Bestimmungen, die dem "Verbraucher den Schutz im Staat eines gewöhnlichen Aufenthalts entziehen" unwirksam. Ist dem Vertragsabschluss allerding ein Angebot oder eine Werbung im Staat des Verbrauchers vorangegangen und hat der Verbraucher den Vertrag im Inland abgeschlossen, so treffen auf ihn die Bestimmungen des innländische Konsumentenschutzgesetzes zu. [1]
- Konsumentenschutzgesetz
Der Kunde genießt laut KSchG ein Rücktrittsrecht von 7 Werktagen, hat der Unternehmer seine Pflicht zur Informationserteilung (Erläuerung zur Ausübung des Rücktrittsrechts, Anschrift des Unternehmers zum Zwecke von Reklamationen, Informationen über Kundendienst und Garantiebediungen, Kündigungsbediungen bei Dauerschuldverhältnissen) versäumt, so verlängert sich diese Frist auf 3 Monate! Bei der Rücktrittserklärung ist das "gesamte Geschäft rückabzuwickeln". Der Verbraucher erhält sein Geld zurück und der Unternehmer einen Wertminderungsersatz. Von diesem Rücktrittsrecht sind einige Fälle ausgeschlossen, z.B. entsiegelte Audio-, Video- oder Software-Datenträger, Zeitschriften (gilt nur für Einzelexemplare!) [1]
Bei einer Auktion im Internet kommt ein ganz normaler Kaufvertrag zustande. Vertragspartner ist entweder das Auktionshaus oder der Anbieter der Ware. Handelt es sich um neue Produkte, hat der Käufer die normalen Gewährleistungsrechte, nämlich Wandelung und Minderung. In den AGB wird in der Regel festgelegt, daß dem Verkäufer vorher Gelegenheit gegeben wird, die Mängel durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu beheben. Ist die Sache danach immer noch mangelhaft, kann der Käufer nach seiner Wahl wandeln, also die Sache gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, oder den Preis angemessen mindern. Diese Ansprüche verjähren in sechs Monaten und können in AGB nicht ausgeschlossen werden.
Bei gebrauchten Waren kann die Gewährleistung durch AGB ausgeschlossen werden, was in der Regel auch gemacht wird. Allerdings ist der Ausschluss unwirksam, wenn der Verkäufer einen ihm bekannten Mangel arglistig verschwiegen hat.
- Arten von Online-Auktionen
Mittlerweile existieren die verschiedensten Ausformungen: - die "normalen" Online-Auktion
- Reverse-Auktionen wie beispielsweise auf www.sixt.de (hier sinkt der Preis solange, bis der erste Bieter zuschlägt)
- Undercover bei www.ricardo.de (eine Art geschlossene Ausschreibung: Jeder Teilnehmer kann genau ein Gebot abgeben, dass aber für die anderen Mitbieter nicht sichtbar ist - der Meistbietende erhält den Zuschlag aber er bezahlt nur die Summe des zweithöchsten Gebotes)
- Powershopping (Interessenten für ein Produkt werden gesammelt die
dann mit Gruppenrabatt billiger einkaufen können) wie beispielsweise
bei www.letsbuyit.com.
- Zusätzliche Features
Einige Auktionshäuser bieten auch die Möglichkeit des automatischen Mitbietens an. Bei diesem Zusatz-Feature handelt es sich um einen elektronischen "Agenten", der während der Abwesenheit des Besuchers auf der Auktionsseite eigenständig mitbietet. Und zwar bis zu einem vom Auktionsteilnehmer festgelegten Preislimit. Weitere Einstellungen, wie zum Beispiel die Schrittweite, in der geboten werden soll, oder das zeitliche Intervall, in dem der Stand gecheckt werden soll sind von Anbieter zu Anbieter verschieden. Außerdem werden den Benutzern meist auch zusätzliche Dienste wie beispielsweise eine Volltextsuche über die sämtliche Auktionsobjekte, die Möglichkeit zu chatten, oder Bewertungsmöglichkeiten der Anbieter geboten.
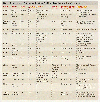 Abb. aus [5]
Abb. aus [5]
- Haftung für Inhalte und Werberecht
Der Auktionator haftet sowohl für eigene als auch für fremde Inhalte. Für letztere allerdings nur, wenn es ihm möglich und zumutbar ist, diese in vertretbarem technischen Aufwand zu kontrollieren und deren Veröffentlichung zu verhindern. Da es ihm in der Regel möglich ist, entsprechende Inhalte zu entfernen, kommt es für dessen Verantwortlichkeit in erster Linie auf dessen positive Kenntnis an. Allerdings bejaht man im allgemeinen die Verantwortlichkeit, wenn es dem Auktionator möglich gewesen wäre, die Angebote von vonrherein herauszufiltern. [8]
Dem Anbieter ist es in wettbewerbsrechtlicher Sicht untersagt, irreführende oder unwahre Angaben über ein Produkt zu machen, die über die wahren Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung hinwegtäuschen. Auch "shill bidding", das eigene Mitbieten um den Preis in die Höhe zu treiben ist unzulässig [8]
In strafrechtlicher Hinsicht sollte der Auktionator die angebotenen Artikel im Auge behalten und inbesondere darauf achten, dass keine pornographischen Inhalte, keine Waffen oder verschreibungspflichtige Medikamente, etc. angeboten werden [8].
Online-Auktionshäuser boten in der vergangenen Zeit alle möglichen und unmöglichen Artikel zum Verkauf an: Nazi-Objekte (www.yahoo.com [9], www.ebay.com), Eizellen (www.ronsagnels.com [14]) , Nieren (www.ebay.com [15]), Menschen (www.ebay.com [16]), Waffen (www.ebay.com), die Wahrheit (www.ebay.com [17]),...
Das offensichtliche Problem ist die Kontrolle der Angebote, da jeder registrierte Benutzer im Prinzip alles mögliche versteigern kann. Die Nutzungsbedinungen der meisten Auktionshäuser verbieten das zwar, aber wirklich verhindern können sie es nicht.
Auch die Abstimmung auf die rechtlichen Gegebenheiten der Länder, in denen die Angebote aufscheinen ist ein latentes Problem, da der Verkauf mancher Waren in einzelnen Ländern verboten ist.
Das Anbieten von sogenannten Raubkopien ist ebenfalls zu verhindern. Sollte trotzdem widerrechtich kopierte Software angeboten werden, so wird der Anbierter (das ist in diesem Fall nicht nur der Verkäufer, sondern auch der Anbieter der Auktions-Plattform) schadenersatzpflichtig [8].
So bringen nun einige Spielehersteller Yahoo vor Gericht mit dem Vorwurf, dass über Auktions- und Shopping-Angebote des Internet-Dienstleisters raubkopierte Spiele verkauft würden.[11]
Nach einer Studie des US-Branchenverbandes Software and Information Industry Association (SIIA) sollen mehr als 90 Prozent der auf Web-Auktionen angebotenen Software raubkopiert sein. SIIA-Mitarbeiter nahmen zwischen dem 31. März und dem 3. April Software-Angebote auf eBay, Yahoo, Amazon.com und FairMarket in Augenschein. In Folge dessen gehen nun einige Anbieter von Computer-Spielen und Spiele-Konsolen gerichtlich gegen das Internet-Portal Yahoo vor. Die Auktions-Plattformen streiten natürlich die Verantwortlichkeit für die Inhalte ab, weil sie "nur die Plattform" zur Verfügung stellen [10]
- Risiko für den Kunden
Generell ist die Gefahr, für dumm verkauft zu werden, sehr groß - z.b. gab www.ricardo.de in der Vergangenheit falsche Richtpreise für Neuwaren an [5], die über dem empfohlenen Verkaufspreis des Herstellers lagen.
Noch dazu muss man sich im Klaren sein, dass man für das Höchstgebot für ein Produkt nicht unbedingt den Zuschlag erhält - es ist nur ein Angebot an den Versteigerer, das dieser annehmen oder ablehnen kann.
Oft sind aber einfach Betrüger am Werk: sie verlangen eine Bezahlung per Vorauskasse - vom Produkt sieht man nie etwas. Es kommt auch vor, dass ein Käufer sich entschliesst, einfach nicht zu bezahlen - die Konsequenzen sind beispielsweise bei www.ebay.de enorm: " Beim ersten Mal: der Käufer wird verwarnt. Beim zweiten Mal: der Käufer wird erneut verwarnt. Beim dritten Mal: der Käufer wird gesperrt". Mit dieser Vorgehensweise hält sich das Auktionshaus aus allen Konflikten heraus - man ist auf sich selbst gestellt, will man den Betrag einfordern bzw. einklagen. Um solche Betrügereien zu erschweren, bieten verschiedene Auktionshäuser sogenannte "Treuhandfonds" in Zusammenarbeit mit Banken an.: der potentielle Käufer überweist das Geld auf diesen Fond, dieses wird dem Verkäufer aber erst ausbezahlt, nachdem der Käufer die Ware erhalten hat.
Einen weiteren Anhaltspunkt für potentielle Käufer bieten die Bewertungen der Versteigerer (nach einem Kauf kann man den Verkäufer mit Noten und Kommentaren beurteilen) - ein Feature, das fast von allen Auktionshäusern angeboten wird.
- Treuhandmodell
Um die Vertragsabwicklung auf beiden Seiten abzusichern, werden verschiedene Treuhandmodelle konzipiert. Allen Modellen gemeinsam ist, daß der Käufer zunächst Zahlung an einen Dritten leistet, bevor der Verkäufer zu liefern verpflichtet ist. Die Freigabe des Geldes kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen: - Versand der Ware - quittierter Zugang der Ware - ausdrückliche Freigabeerklärung durch den Käufer Derartige Modelle befinden sich noch in der Entwicklung. Insbesondere werden Treuhandfunktionen bisher nur von den Auktionshäusern selbst, nicht von einem neutralen Dritten angeboten, allerdings geht der Trend in Richtung Kooperationen mit Banken. [8], [13]
- Nutzen
Wie sinnvoll es überhaupt ist, beispielsweise einen Artikel der normalerweise ATS 1000 kostet, um ATS 800 zu erwerben, sei dahingestellt. Man sollte in diese Kalkulation auch die anfallenden Online-Kosten, die aufgewendete Zeit, die Versandkosten und das Risiko miteinbeziehen. Das es Spass machen kann, etwas zu ersteigern ist ein anderer Aspekt, aber man sollte sich auf alle Fälle gut über das angebotene Produkt informieren.
- Zukunftsperspektiven
Die Menge der Auktionshäuser wird sicher noch steigen, ihre Aktienkurse auch. Wieviele überleben werden ist fraglich. Die beiden größten Auktionshäuser in Deutschlang www.ricardo.de und www.ebay.de haben bereits eine kleine Gebühr pro privater Versteigerung eingeführt um die Flut an unüberlegten Angeboten einzudämmen. Schon jetzt ist die Menge der versteigerten Artikel unüberschaubar (~ 380.000 Artikel bei www.ricardo.de - Stand 13.5.2000), auch wenn sie recht gut gegliedert sind wie bei www.ebay.de. Auch die Rechtslage muss sich noch gravierend ändern, denn momentan ist der Kunde dem Gutdünken des Verkäufers ausgeliefert. Hoffentlich passt man die Bestimmungen für Auktionen in einer EU-Richtlinie den Gegebenheiten des E-Commerce an und in der Folge die Gesetzgebungen der einzelnen EU-Staaten. Bis dahin ist höchste Vorsicht bei beiden Vertragspartnern geboten.
- Anmerkungen
Die Bezugsquellen zu diesem Text stammen zum Grossteil aus Deutschland, doch eine ähnliche Rechtslage in Österreich ernöglicht einen Schluss auf die anzunehmende Rechtssprechung.